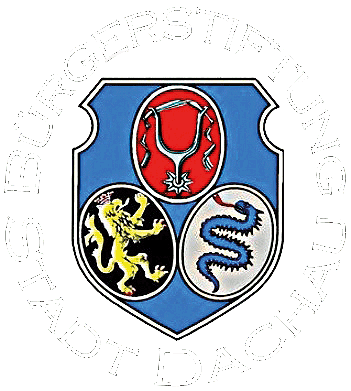- Aktuelle Seite:
- Startseite
- Infos
- Neuigkeiten
- 2018
Die Tötungsanstalt Hartheim
Artikel von Klemens Hogen-Ostlender
Der Bischof von St. Pölten, Michael Memelauer, fand in seiner Silvesterpredigt am 31. Dezember 1943 deutliche Worte gegen das, was gut 100 Kilometer entfernt in der „Schwachsinnigenanstalt“ Hartheim unter dem Deckmantel Euthanasie („Gnadentod“) geschah: Die systematische Ermordung von Menschen, denen die Nationalsozialisten das Lebensrecht absprachen. „Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben“ bekräftigte der Bischof und betonte die Morde würden die Strafe Gottes herausfordern. In sechs Tötungsanstalten im ganzen Deutschen Reich wurden im Rahmen der „Aktion T4“ 70 273 Männer und Frauen „desinfiziert“, wie die Tarnbezeichnung lautete. Hartheim war in zweierlei Hinsicht eine Ausnahme. Dort ging das Töten auch weiter, nachdem die Morde in den übrigen Anstalten beendet worden waren. Hartheim war auch die letzte Station des Lebensweges für 332 Priester, die aus Konzentrationslagern, meist aus dem KZ Dachau, dorthin verschleppt wurden. Auch das irdische Leben mehrerer seliggesprochener Dachauer Märtyrer endete dort.
In Hartheim wurde nach dem Krieg eine Statistik entdeckt, die mit einer Kostenberechnung rechtfertigen wollte, was in der Gaskammer geschehen war. Bei einer weiteren Lebenserwartung der Opfer von zehn Jahren seien Lebensmittel im Wert von insgesamt 141 775 573,80 Reichsmark eingespart worden.
Auf Schloss Hartheim, das rund zehn Kilometer westlich von Linz an der Donau liegt, hatte der Landes-Wohltätigkeitsverein von Ober-Österreich 1898 ein Heim für „Schwach- und Blödsinnige, Cretinöse und Idioten“ eröffnet, in dem rund 200 geistig und mehrfach Behinderte betreut wurden. Bis in die 1930-er Jahre entwickelte sich hier für damalige Verhältnisse fortschrittliches Modell der Behindertenfürsorge.
„Aufartung“
Bald nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 beanspruchte das Regime in ganz Deutschland die ausschließliche Kontrolle über die gesamte Sozialpolitik als zentrale Voraussetzung für die Errichtung einer „erbgesunden und arischen Volksgemeinschaft“. Nach dem „Anschluss“ galt das ab 1938 auch für Österreich. Schloss Hartheim war nun Eigentum des Reichsgaus Oberdonau. Die Patienten wurden teilweise in andere Heime verlegt. Die Insassen einer Taubstummenanstalt sollten eigentlich nach Hartheim kommen. Adolf Hitlers auf den 1. September 1939 datierter „Gnadentod-Erlass“ bestimmte es anders. „Geistig und körperlich Minderwertige“ sollten im Rahmen der „Aktion T4“, benannt nach der Adresse Tiergartenstraße 4 in Berlin, wo sie geplant wurde, getötet werden. Mit den Morden beauftragte Hitler nicht eine staatliche Behörde, sondern die „Zentraldienststelle T4“ seine private „Kanzlei des Führers“. Die „Aktion T4“ war Teil einer stufenweisen Verwirklichung der „Aufartung“ oder „Aufnordung“ des deutschen Volkes. Jede „Beeinträchtigung des deutschen Volkskörpers“ sollte verhindert werden. An die Stelle des Heilens trat in vielen Fällen das „Vernichten“. In den Tötungsanstalten waren insgesamt 20 Ärzte mit den Morden beauftragt. Planziel waren 100 000 Opfer, wie aus einem Tagebucheintrag von Propagandaminister Joseph Goebbels vom 31. Januar 1941 hervorgeht: „40 000 sind weg, 60 000 müssen noch weg“. Am 24. August 1941 gab Adolf Hitler nach Protesten die mündliche Weisung, die „Aktion T4“ zu beenden und damit die „Erwachseneneuthanasie“ einzustellen. Das „Fachwissen“ des bisherigen Hartheimer Verwaltungspersonals wurde nun für die „Aktion Reinhardt“, die systematische Ermordung der Juden und Roma des Generalgouvernements, benötigt. Einige der Hartheimer Verwaltungsbeamten stiegen zu Lagerkommandanten von dortigen Vernichtungslagern auf. Die meisten gehörten schließlich der „Sonderabteilung Einsatz R“ an, einer eigenständigen Abteilung des SS-Polizeiapparats, in der sie in der Operationszone Adriatisches Küstenland ihr Mordhandwerk weiterbetrieb. Als entscheidend für das Ende der Aktion T4 werden die Predigten des Bischofs von Münster, Clemens August Graf von Galen, angesehen.
Aktion 14f13
Die sogenannte „Kinder-Euthanasie“ wurde jedoch ebenso fortgesetzt wie die dezentrale Tötung behinderter Erwachsener in einzelnen „Heil- und Pflegeanstalten“ durch Nahrungsentzug sowie Verabreichung von Medikamenten. Außerdem wurden in drei Tötungsanstalten, darunter Hartheim, unter der Bezeichnung „Aktion 14f13“ kranke beziehungsweise nicht mehr arbeitsfähige KZ-Häftlinge, wie zum Beispiel zahlreiche Gefangene aus dem Priesterblock des KZ Dachau, ermordet. Die Ziffern- und Buchstabenkombination der neuen Mordserie setzt sich zusammen aus dem Einheitsaktenplan der SS. „14“ kennzeichnet den Inspekteur der Konzentrationslager, „f“ stand für Todesfälle und „13“ für die Tötung durch Gas. Nach dem Abbruch der Morde an Psychiatriepatienten und Behinderte, denen allein in Hartheim mehr als 18 000 Menschen zum Opfer fielen, folgte bis 1944 in Schloss Hartheim im Rahmen der NS-Aktion 14f13 die Ermordung von 12 000 KZ-Häftlingen. Auch der junge deutsche Priester Hermann Scheipers war bereits in Dachau als „Kandidat“ für Hartheim in den Invalidenblock gekommen. In seinen Erinnerungen berichtete der Geistliche, der 2016 kurz vor seinem 103. Geburtstag starb, wie seine Zwillingsschwester Anna, die er verständigen konnte, ihn rettete. Sie ließ im Reichssicherheitshauptamt in Berlin beim zuständigen Sachbearbeiter für die Priester im KZ Dachau durchblicken, daheim im Münsterland sei es ein offenes Geheimnis, dass auch Priester vergast werden. Das katholisch geprägte Münsterland drohe dann dem Einfluss des Regimes zu entgleiten, notierte Propagandaminister Goebbels zu dieser Zeit nervös in sein Tagebuch. Das Wort „Vergasung“ durfte auf keinen Fall nach außen dringen, wusste der Sachbearbeiter. Noch am selben Tag, dem 13. August 1942, riss jemand im KZ Dachau die Tür des Invalidenblocks auf und rief: „Alle reichsdeutschen Pfaffen müssen hier raus!“ Hermann Scheipers durfte von den Todgeweihten zurückkehren. Seine Schwester hatte nicht nur ihn, sondern auch zahlreiche andere Priester vor der Hartheimer Gaskammer gerettet.
Der Kreis der Opfer wird ausgedehnt
Die Konzentrationslager, in die immer mehr Häftlinge eingewiesen wurden, sollten durch die neue Mordaktion „entlastet“ werden. Der Kreis der Opfer wurde bald erweitert auf Juden und „Asoziale“. Nach den damaligen Richtlinien waren damit „Zigeuner, Landfahrer, Landstreicher, Arbeitsscheue, Müßiggänger, Bettler, Prostituierte, Querulanten, Gewohnheitsverbrecher, Raufbolde, Verkehrssünder und Psychopathen“ gemeint. In Hartheim wurden zudem ab 1942 auch nicht mehr arbeitsfähige Zwangsarbeiter aus dem Osten, sowjetische Kriegsgefangene und ungarische Juden in der Gaskammer getötet. Die Aktion 14f13 endete mit dem letzten Häftlingstransport nach Hartheim am 11. Dezember 1944. Die Einrichtung der Gaskammer wurde anschließend entfernt und die Spuren ihrer Nutzung so weit wie möglich beseitigt.
Die „Landesanstalt Hartheim“, so die neue, offizielle Bezeichnung, trat während der Mordaktionen nach außen als Institution der Gau-Fürsorgeverwaltung auf. Für den nötigen Umbau wurden zunächst eine Art Hausmeister, ein Handwerker, der später im Krematorium arbeitete und ein Tischler eingestellt. Ein Raum wurde mit gasdichten Türen versehen, von denen eine ein Guckloch bekam. Ein Nebenraum diente als Lager für Gasflaschen. In einem weiteren Raum wurden die Opfer vor der Vergasung fotografiert. Im späteren Krematorium wurde ein Ofen installiert. Zur Belegschaft gehörten außer den Ärzten Fahrer für die Busse, die die Todeskandidaten nach Hartheim brachten, „Pflege“-Personal, Fotografen und Brenner für das Krematorium. Einer der Brenner, Vinzenz Nohel, legte nach dem Krieg als Angeklagter vor Gericht dar, dass er selbst und seine Kollegen überdurchschnittlich bezahlt wurden. Es gab 170 Reichsmark im Monat plus zu 50 Mark Trennungszulage, freie Unterkunft und Verpflegung, 35 Mark Erschwernis-Zulage, 35 Mark Schweigeprämie und eine tägliche Schnapsration von einem viertel Liter. Das war fast das Doppelte des üblichen Monatslohns eines Arbeiters von 160 Mark, von dem noch dazu Miete und Lebensmittel bezahlt werden mussten.
Freizeitgestaltung
Ab Juli 1941, jedenfalls aber noch vor dem Stopp der Aktion T4, trafen Häftlingstransporte aus den nicht weit entfernten Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen als Beginn der neuen Mordserie in Hartheim ein. Im September 1941 begutachteten die T4-Ärzte 2000 Häftlinge, die „in Frage kamen“, im Konzentrationslager Dachau. Die Aktion „14 f 13“ beanspruchte lediglich die technische Infrastruktur in Hartheim. Die „Verwaltungsarbeit“ wurde von der Bürokratie in Dachau und anderen Konzentrationslagern erledigt. Eine nochmalige Begutachtung der Opfer vor der Ermordung hatte nur den Zweck, goldenen Zahnersatz festzustellen. In Hartheim brauchte es 60 bis 70 Personen für die Durchführung der „Aktion“. Die meisten wohnten auch im Schloss. Der Massenmord war wohl in keiner Tötungsanstalt so eng mit dem Alltagsleben des Personals verflochten wie in Hartheim. Allein aufgrund der räumlichen Gegebenheiten war Ausweichen oder Wegsehen unmöglich. Der Kühlraum für Lebensmittel für das Personal lag zwischen Auskleideraum und Aufnahmeraum der Opfer, sodass der Koch oder die Küchenhilfen sich mehr als einmal durch eine Gruppe von Todeskandidaten drängen mussten, um die benötigten Lebensmittel aus dem Kühlraum zu holen. Für Ausflugsfahrten zur Stärkung des „kameradschaftlichen Zusammenhalts“ wurden dieselben Autobusse benutzt, in denen sonst die Opfer in die Tötungsanstalt transportiert wurden. Der stellvertretende ärztliche Leiter in Hartheim, Dr. Georg Renno, Parteimitglied seit 1930, erfreute die weibliche Belegschaft der Tötungsanstalt des Öfteren mit Hausmusik. Eine Schreibkraft erinnerte sich 1965 in einer Zeugenaussage, „dass Dr. Renno manchmal Sonntag vormittags im Innenhof des Schlosses Hartheim Flöte gespielt hat. Ich interessierte mich für sein Flöten- und Akkordeonspiel. An manchen Abenden ist gesungen worden, es beteiligten sich daran einige Mädchen.“
Der Ablauf der Morde
In der ersten Maihälfte 1940 traf der erste T4-Transport in Hartheim ein. Es waren Patienten der Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart, unter ihnen auch ehemalige Pfleglinge aus Hartheim. Weil wegen der hohen Zahl von Opfern bald größere Busse angeschafft werden mussten, die nicht durch das Tor in den Schlosshof fahren konnten, wurde neben einem Seiteneingang ein Holzschuppen errichtet, von dem aus die Todeskandidaten in den Entkleidungsraum geführt wurden. Anfangs mussten sich die Opfer im Schlosshof ausziehen. Das hatte bei den Helfershelfern der Mörder „immer für eine gewisse Unruhe gesorgt“, so eine Zeugenaussage nach dem Krieg. Das dienstverpflichtete „Pflegepersonal“ entkleidete die Opfer. Ein Pfleger, der aus der Heilanstalt Ybbs an der Donau nach Hartheim versetzte Franz Sitter, blieb allerdings nur zehn Tage im Schloss. Er verlangte seine sofortige Enthebung von der Dienstverpflichtung, als er sah, um was es im Schloss ging. Er wurde an seinen alten Arbeitsplatz zurückversetzt und kurz darauf zur Wehrmacht eingezogen. In Hartheim war er vom Kriegsdienst freigestellt gewesen. Sitter blieb das einzige Mitglied der Belegschaft, das mit dieser Konsequenz auf die Situation in Hartheim reagierte. Sitter überlebte den Krieg, arbeitete danach zuerst als Pfleger in einem amerikanischen Militärlazarett und dann bis zu seiner Pensionierung 1967 wieder in der Heilanstalt in Ybbs. Er starb 1980.
Nach Überprüfung der Identität wurden die „medizinisch interessanten“ Opfer fotografiert. Dann kamen alle Todeskandidaten, bei großen Transporten mehr als 60 Menschen, in die Gaskammer, die zur Tarnung wie ein Duschraum eingerichtet war. Eine Pflegerin sagte nach dem Krieg aus: „Wenn sie ansprechbar waren, sagte man ihnen, sie würden gebadet. Viele freuten sich auf das Baden, auch wenn sie sonst nichts erfassten. Manche wollten sich nicht waschen lassen, man musste sie ins Bad zerren“. Wenn die luftdichten Türen verschlossen waren, ließ ein Arzt oder (vorschriftswidrig) auch einer der Brenner durch Öffnen des Gashahns in einem Nebenraum das Gas, farb-, geruchs- und geschmackloses Kohlenmonoxid, einströmen. Nach zehn bis 15 Minuten Gaszufuhr waren die Menschen in der Gaskammer tot. Nach einer Stunde wurde der Raum entlüftet, und die Leichen in den Totenraum gebracht. Die Brenner brachen alle Goldzähne aus und entfernten goldenen Zahnersatz. Die „medizinisch Interessanten“ wurden obduziert, die anderen im Krematoriumsraum verbrannt. Der Ofen, der für jeweils zwei Leichen ausgelegt war, war phasenweise praktisch ständig in Betrieb. Der überlastete Kamin geriet nach einigen Monaten in Brand, was beinahe das ganze Schloss eingeäschert hätte. Ein Teil der Asche wurde in Urnen gefüllt, der Rest zunächst in Säcken zur nahe gelegen Donau gebracht und dort in den Fluss gekippt. Weil die häufigen Transporte den Argwohn der Bevölkerung verstärkten, wurde die Asche bald aber im Schlossgarten vergraben oder auf dem Dachboden des Schlosses gelagert.
Vertuschung der Verbrechen
In Schloss Hartheim waren bereits bis August 1941 18.269 Menschen ermordet und verbrannt worden. Davon sollte möglichst nichts an die Öffentlichkeit dringen. Ein eigens Sonderstandesamt beurkundete die Todesfälle. Die Angehörigen wurden zunächst registriert. Die Ziffern- und Buchstabenkombination der neuen Mordserie setzt sich zusammen aus dem Einheitsaktenplan der SS. Dabei kennzeichnete „14“ den Inspekteur der Konzentrationslager, „f“ stand für Todesfälle und „13“ für die Tötung durch Gas. Mit Zeitverzögerung wurden die Angehörigen von der Verlegung aus der Abgabeanstalt nach Hartheim informiert. Zu diesem Zeitpunkt waren die Opfer oft bereits tot. Jeweils zehn bis 20 Tage nach einem Mord bekamen die Angehörigen einen „Trostbrief“, der beispielsweise so begann: „In Erfüllung einer traurigen Pflicht müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Tochter […] unerwartet am 18. Juni 1940 infolge Bauchspeicheldrüsenentzündung verstorben ist. Eine ärztliche Hilfe war leider nicht mehr möglich. Da jedoch bei der Art und der Schwere des Leidens ihrer Tochter mit einer Besserung und damit auch mit einer Entlassung aus der Anstalt nicht mehr zu rechnen war, kann man ihren Tod, der sie von ihrem Leiden befreite und sie vor einer lebenslänglichen Anstaltspflege bewahrte, nur als Erlösung für sie ansehen; möge Ihnen diese Gewissheit zum Trost gereichen. Um einer möglichen Seuchengefahr, die jetzt während des Krieges besonders groß ist, vorzubeugen, musste die Verstorbene auf polizeiliche Anordnung hin sofort eingeäschert werden“. Die Briefe endeten jeweils mit „Heil Hitler!“ Auf Wunsch bekamen die Hinterbliebenen eine Urne mit Asche zugesandt, die aber wahllos eingefüllt war und keineswegs die Asche des getöteten Angehörigen enthielt. Auch die Sterbedaten wurden gefälscht und obendrein Todesnachrichten von Ermordeten aus der näheren Umgebung von Hartheim aus einer weit entfernten Tötungsanstalt verschickt. Ein Kurierdienstauto wurde eigens für die Aktenverschiebungen zwischen den Anstalten angeschafft. Angehörige glaubten deshalb an ein Versterben ihrer Lieben in einer jeweils sehr weit entfernten Anstalt. Persönliche Besuche und Nachforschungen vor Ort wurden in die Irre geleitet und weitere Reklamationsversuche durch die dafür nötigen weiten Reisen erschwert. Zum Mordgeschäft kam außerdem Sozialbetrug hinzu. Den Kostenträgern wurden Rechnungen für Quartier, Kost und Pflege über Wochen und Monate ausgestellt, obwohl die Personen sofort bei ihrer Ankunft getötet wurden. Auch das diente der Bereicherung der Anstalten durch die Verrechnung der angeblich damit verbundenen Kosten.
Die Ortschaft Hartheim
Die Ortschaft Hartheim zählte 1939 22 Häuser und hatte 97 Einwohner. Die meisten von ihnen waren in der Landwirtschaft beschäftigt. Es gab eine Gemischtwarenhandlung, eine Bäckerei und ein Wirtshaus. Knapp ein Dutzend Mädchen und Frauen aus dem Ort arbeiteten in der „Schwachsinnigenanstalt“ als Wäscherinnen und Putzfrauen. Ein Handwerksmeister leitete die arbeitsfähigen männlichen Patienten beim Korbflechten und Bürstenbinden an. Im Wirtschaftshof arbeitete und wohnten die Familie des Gutsverwalters und einige Landarbeiter. Mit der Einrichtung der Tötungsanstalt veränderte sich das Beziehungsgefüge grundlegend. War vor 1939 eine relativ große Anzahl der Ortsbewohner durch ein Dienstverhältnis mit dem Schloss verbunden gewesen, reduzierte sich diese Anzahl 1940 auf zwei: Eine Gartenarbeiterin und eine Küchenhilfe. Den Menschen im Dorf wurde angedroht, dass eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht die Einweisung in ein Konzentrationslager bedeuteten würde. Die Tatsache, dass immer wieder neue vollbesetzte Busse ankamen, aber nie jemand die Anstalt verließ, die dauernde Rauchentwicklung und der Verbrennungsgeruch aus dem Krematorium ließen vollends keine Zweifel darüber aufkommen, was im Schloss geschah. Handwerker, die die Tötungsanlagen eingerichtet hatten oder sie reparieren mussten, sprachen über ihre Beobachtungen. Eine Bäckerin, die Brot ins Schloss lieferte, sah einmal nackte Leichen im Hof liegen. Mehrere Helfer der Mordaktion wohnten im einzigen Gasthof des Orts, andere bei Bauern der Umgebung. Mit dem Abbruch der Aktion T4 und dem Auslaufen der ersten Phase von „14 f 13“ wurde außerdem nicht mehr in der alten Striktheit auf die Distanz zum Ort geachtet.
Widerstand
Die Schuhmanns, deren Bauernhof direkt neben dem Schloss steht, waren als Christlichsoziale Gegner des Nationalsozialismus. Einer der Söhne, Karl, fotografierte 1941 das Schloss mit rauchendem Schornstein. Sein Bild ist das einzige existierende einschlägige Fotodokument. Sein Bruder Ignaz nahm 1943 Kontakt zu einem anderen Regimegegner auf, dem sozialdemokratischen Eisenbahner Leopold Hilgarth. In der Nacht des 16. Februar 1943 schrieben sie neben dem Eingangstor an die Wand des Wirtschaftstraktes: „Österreicher! Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden!“ Eine Woche später stand auf einem Silo die Parole: „Nieder mit Hitler! Wir wollen einen Kaiser von Gottes Gnaden, aber keinen Mörder aus Berchtesgaden!“ Schuhmann und Hilgarth fertigten auch Flugblätter an, in denen sie die lokalen Nationalsozialisten als Handlanger der NS-Mörder bezeichneten. Hans Keppelmüller unterstützte die Gruppe bei der Beschaffung von Papier. Anfang 1944 beteiligte sich auch Karl Schuhmann an den Aktionen. Die drei vervielfältigten Flugblätter und verteilten sie in Linz und Eferding. Ein Gestapo-Spitzel wurde der Gruppe zum Verhängnis. Im Juni 1944 wurden Ignaz Schuhmann, Hans Keppelmüller, Leopold Hilgarth, Karl Schuhmann und Ignaz Schuhmann senior verhaftet. Schuhmann senior wurde nach drei Monaten Untersuchungshaft freigelassen, den anderen wurde in Wien der Prozess gemacht. Am 3. November 1944 erging das Urteil: Versetzung in ein Strafkompanie für Hans Keppelmüller, zehn Jahre schweren Kerkers für Karl Schuhmann. Leopold Hilgarth und Ignaz Schuhmann wurden zum Tod durch das Fallbeil verurteilt und am 9. Januar 1945 hingerichtet.
Die Morde in der Tötungsanstalt beschäftigten 1940/41 auch die Strafverfolgungsbehörde in Linz. Im Oktober 1940 zeigte ein Vater den mysteriösen Tod seines Sohnes in Hartheim bei der Staatsanwaltschaft an. Er hegte den Verdacht, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Die Behörden des Reichsgau Oberdonau ersuchten Oberstaatsanwalt Ferdinand Eypeltauer das Verfahren einzustellen. Eypeltauer, der seit 1936 NSDAP-Mitglied war, entschied anders. Er ordnete an, den verantwortlichen Arzt auf Schloss Hartheim auszuforschen und als Beschuldigten vernehmen zu lassen. Im September 1941 erhielt Eypeltauer aber die Anordnung, das Verfahren einzustellen. Er gehorcht, legte dann sein Amt nieder und setzte seine Laufbahn als Landgerichtsdirektor in Linz fort. In dieser Funktion verhängte er auch drei Todesurteile gegen einen Fahrraddieb und zwei „Volksschädlinge“.
Nach Kriegsende
Rudolf Lonauer, ärztlicher Leiter der Tötungsanstalt Hartheim, vernichtete im Frühling 1945 alle Unterlagen, die in einem Zusammenhang mit den Krankenmordaktionen standen. Am 5. Mai 1945 beging er zusammen mit seiner Frau Selbstmord, nachdem das Ehepaar seine beiden Kinder getötet hatte. Nach dem Krieg ging es in zwei Prozessen in Österreich und einem weiteren Verfahren in Deutschland um die Hartheimer „Euthanasie“-Verbrechen. Da einige Täter nach dem Abbruch der Aktion T4 im Osten für weitaus mehr Todesopfer verantwortlich waren, wurde manchen dafür der Prozess gemacht, während ihre Mordtaten in Hartheim ungesühnt blieben. Beim ersten Prozess vor dem Volksgericht Linz wurden zwei „Pfleger“ 1946 zu dreieinhalb beziehungsweise zweieinhalb Jahren schweren Kerkers wegen Beteiligung an Morden und Misshandlungen verurteilt. Sechs Pflegerinnen, deren Tätigkeit als „notdienstverpflichtet“ gewertet wurde, erhielten Freisprüche. Zur Vorbereitung des Hauptverfahrens wurde gegen 61 Beschuldigte (43 Männer und 18 Frauen) ermittelt. Es handelte sich um drei Ärzte, 23 Mitglieder des „Pflege“personals, 16 Verwaltungskräfte, vier Kraftfahrer, sechs Brenner sowie sechs Männer und drei Frauen, deren genaue Funktion unbekannt war. Im Juli 1948 begann schließlich die Hauptverhandlung, allerdings gegen lediglich drei Angeklagte. Zwei „Pfleger“ erhielten fünfeinhalb beziehungsweise drei Jahre Haft, ein weiterer wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte bei 13 Beschuldigten die Anklage zurückgelegt, weil es keine Gründe zur Strafverfolgung gebe und bei 22 weiteren das Verfahren wegen Nichtauffindbarkeit der Täter abgebrochen. 13 Beschuldigte mussten sich in anderen Verfahren verantworten und sieben waren nicht mehr am Leben. Bei drei weiteren Personen ist der Ausgang des Ermittlungsverfahrens nicht mehr nachvollziehbar. Eine Anklage erfolgte gegen sie jedenfalls nicht.
Franz Stangl, Büroleiter in Schloss Hartheim, war der „prominenteste“ Täter, der sich anderweitig verantworten musste. Während der Aktion Reinhardt wurde er Kommandant der Vernichtungslager Sobibor und Treblinka. Nach dem Krieg flüchtete er wegen der Linzer Hartheim-Prozesse 1948 zuerst nach Syrien und emigrierte 1951 nach Brasilien. 1967 wurde er nach Deutschland ausgeliefert und 1970 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er legte Berufung ein und starb 1971 in der Haftanstalt an Herzversagen. Vinzenz Nohel, einer der Brenner aus Hartheim, wurde als einziger der Täter 1947 hingerichtet, nachdem ein amerikanisches Militärgericht ihn im Mauthausen-Hauptprozess in Dachau zum Tode verurteilt hatte. Von 1967 bis 1970 versuchte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Georg Renno des Mordes zu überführen. Renno hatte sich bei Kriegsende nach Ludwigshafen abgesetzt und unter dem Namen Georg Reinig die Praxis eines Arztes übernommen, der sich noch in Gefangenschaft befand. Er wurde außerdem von einem Pharmakonzern als wissenschaftlicher Mitarbeiter eingestellt. Ab Januar 1955 trat er wieder unter seinem richtigen Namen auf, obwohl er in Österreich mit Haftbefehl gesucht wurde. Das Verfahren gegen ihn wurde schließlich eingestellt. Die Universitätsklinik Mainz bescheinigte Renno wegen Gefäßverkalkung dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit. Renno lebte noch weitere 27 Jahre, bis er 1997 kurz vor seinem 91. Geburtstag in Neustadt an der Weinstraße starb. Im Prozess hatte er abgestritten, jemals bei einer Vergasung dabei gewesen zu sein. Später meinte er, es sei „keine große Sache gewesen, den Gashahn aufzudrehen“. Reue zeigte er nie. Im hohen Alter sagte er bei einem Interview: „Ich selbst habe ein ruhiges Gewissen. Ich fühle mich nicht schuldig, in dem Sinne wie – ja, wie einer, der jemanden erschossen hat […] Nachdem ich ja gesehen habe, wie die Leute gestorben sind, muss ich mir sagen, das war keine Qual für die, ich möchte eher sagen, in Anführungszeichen: Es war eine Erlösung“.
Der aus Prozessunterlagen zusammengestellte sogenannte „Renno-Akt“ wurde aber eine der wichtigsten Informationsquellen für österreichische Forschungsprojekte zu diesem Thema, die oft erst Jahrzehnte später initiiert wurden.
Im Schloss gibt es seit 2003 den Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim. Die baulichen Spuren der Tötungsanstalt wurden dafür wieder freigelegt und gesichert. Unmittelbar anschließend an die Tötungsräume wurde ein Raum der Stille gestaltet. In den ehemaligen Arbeitsräumen der Täter werden umfassende historische Informationen präsentiert. Bereits 2001 wurde am Donauufer in Höhe der Ortschaft Gstocket, wo die Asche der Mordopfer aus Hartheim in den Fluss geschüttet wurde, auf Initiative des Vereins Schloss Hartheim ein Gedenkstein errichtet. Die Inschrift auf dem sehr großen Donaukiesel stammt von dem oberösterreichischen Schriftsteller Franz Rieger: „Das Wasser löschte die Spuren, die das Gedächtnis bewahrt.“ Eine Informationstafel erläutert die historischen Zusammenhänge.
Literaturverzeichnis
Aly, Götz (Hrsg.): Aktion T4 1939–1945. Die „Euthanasie“-Zentrale in der Tiergartenstraße 4. Fischer Taschenbuch, Berlin, 1989
Benzler, Susanne mit Perels, Joachim: Justiz und Staatsverbrechen – Über den juristischen Umgang mit der NS-„Euthanasie“. In: Loewy, Hanno und Winter, Bettina (Hrsg.): NS-„Euthanasie“ vor Gericht. Campus-Verlag, Frankfurt, 1996
Burleigh, Michael (Hrsg.): Tod und Erlösung. Euthanasie in Deutschland 1940 – 1945. Pendo Verlag, Zürich, 2002
Freund, Florian: Der Dachauer Mauthausenprozess. In: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.): Jahrbuch 2001. Wien
Fröhlich, Elke: Joseph Goebbels – Die Tagebücher. Sämtliche Fragmente,De Gruyter, Berlin, 1987.
Garscha, Winfried und Scharf, Franz: Justiz in Oberdonau. Oberösterreichisches Landesarchiv, Linz, 2007.
Kepplinger, Brigitte: Die Tötungsanstalt Hartheim 1940 – 1945. www. Education Group, www.eduhi.at, abgerufen 7.10.2018
Klee, Ernst: „Euthanasie“ im NS-Staat: die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Fischer-Taschenbücher, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2009
Klee, Ernst: Der alltägliche Massenmord. Zeit online, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Hamburg, 1990. Abgerufen am 13.10.2018
Kohl, Walter: „Ich fühle mich nicht schuldig.“ Georg Renno – Euthanasiearzt. Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2000
Matzek, Thomas: Das Mordschloss. Auf der Spur von NS-Verbrechen in Schloss Hartheim. Kremayr & Scheriau, Wien, 2002
Memelauer, Michael: Silvesterpredigt vom 31.12. 1943. Diözesanarchiv, St. Pölten abgerufen 30.09. 2018
Morsch, Günther und Perz, Bertrand: Neue Studien zu nationalsozialistischen Massentötungen durch Giftgas. Metropol Verlag, Berlin, 2001
Scheipers, Hermann: Gratwanderungen. Priester unter zwei Diktaturen. 3. Auflage. Benno-Verlag, Leipzig. 1997
Zamecnik, Stanislav (Hrsg): Das war Dachau. Die Zeit des Nationalsozialismus. Comité International de Dachau, Fischer-Taschenbücher, S. Fischer, Frankfurt am Main, 2002
Um finanzielle Unterstützung wird gebeten.
Spendenkonto
DE54 7005 1540 0280 8019 29
BYLADEM1DAH